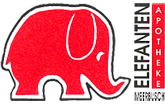Ratgeber

Bei Kindern Husten lindern
Mit Saft und Wickel
Wenn Babys oder kleine Kinder von Husten geschüttelt werden, leiden die Eltern richtig mit. Zum Glück steckt meist nur eine Erkältung dahinter. Deshalb lässt sich mit Hausmitteln und Hustensaft gut dagegen angehen. Wenn der Husten jedoch nicht besser wird, muss das Kind zur Ärzt*in. Gleiches gilt bei Alarmsymptomen wie Nasenflügelatmen oder Bluthusten.
Ausputzer Husten
Jeden Tag gelangen massenweise Partikel wie Staub und Pollen, aber auch Schadstoffe und Krankheitserreger in unsere Atemwege. Um sie zu entfernen, haben Luftröhre und Bronchien ein Selbstreinigungssystem: Es besteht aus Millionen von Flimmerhärchen, die auf der Schleimhaut der Atemwege sitzen, und einer dünnen klebrigen Schleimschicht. In diesem Schleim bleiben Viren, Staub und Fremdstoffe zunächst hängen. Weil die Flimmerhärchen fortwährend in Richtung Rachen schlagen, wird der Schleim inklusive Partikel dorthin transportiert. Dort wird er verschluckt und über den Darm ausgeschieden.
Bei einer Infektion der Atemwege muss dieses Reinigungssystem besonders viel leisten. Es sammelt sich mehr Schleim an als sonst, der dann einen Reiz verursacht und ausgehustet wird. Durch diese Schutzreaktion werden nicht nur die Viren ausgeschieden, sondern auch die Heilung der gestressten Atemwegsschleimhäute unterstützt. Denn das Abhusten großer Schleimmengen befreit die Bronchien und erleichtert das Atmen.
Tipp: Flimmerhärchen brauchen es feucht: trocknen die Schleimhäute der Atemwege aus, können sie ihre natürliche Reinigungsfunktion nicht mehr erfüllen. Wer erkältet ist sollte trockene Heizungsluft also meiden.
Wie Husten quälen kann
Husten ist ein häufiger Begleiter von viral ausgelösten Erkältungskrankheiten. Deshalb husten Kinder viel öfter als Erwachsene. Ihr Immunsystem ist noch nicht „fertig“, so dass Erkältungsviren ein leichtes Spiel haben. In den ersten beiden Lebensjahren haben die Kleinen durchschnittlich 13 Infektionen. Bei Kleinkindern bis vier Jahren sind bis zu zehn Atemwegsinfekte pro Jahr normal, wobei die Zahl der Erkältungen mit Eintritt in eine Kindertagestätte ansteigt.
Husten belastet den Organismus auf vielerlei Arten: Ist er intensiv und häufig, strengt er den kleinen Körper richtig an. Erschöpfung und Schlafstörungen beeinträchtigen die Erholung und Leistungsfähigkeit am Tag. Anhaltender Husten reizt die Atemwege,kann Halsschmerzen auslösen und das Essen und Trinken erschweren. Häufige Hustenattacken schränken zudem beim Spielen ein und erhöhen die Fehltage in der Kita und Schule.
Auch die Familie leidet mit, wenn Kinder dauernd am Husten sind. Eltern machen sich Sorgen, werden manchmal auch genervt, was wiederum ein schlechtes Gewissen auslöst. Insgesamt kann starker und häufig wiederkehrender Husten das Zusammenleben erheblich erschweren.
Hinweis: Bei sehr ausgeprägtem Husten drohen Atemnot und Sauerstoffmangel. Dazu kommt es aber nur, wenn ernsthafte Erkrankungen die Ursache sind oder eine harmlose Erkältung einen schweren Verlauf nimmt.
Was hinter dem Husten steckt
Meist ist der Husten im Kindesalter auf eine Erkältung zurückzuführen und bleibt harmlos. Trotzdem kann er langwierig sein – oft dauert es bis zu drei Wochen, bis er wieder abgeklungen ist. Wichtig ist, dass die Kinder trotz des Hustens normal und geräuschlos atmen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Kinder trotz Husten ausreichend mit Sauerstoff versorgt sind.
In manchen Fällen nimmt eine eigentlich harmlose Erkältung aber auch einen schweren Verlauf. Dann erreichen die Krankheitserreger die unteren Atemwege oder sogar die Lunge und lösen dort eine Bronchitis oder Lungenentzündung aus. Das ist etwa bei 20-30% der Säuglinge und Kleinkinder der Fall. Besonders häufig kommt dies bei einer Infektion mit Influenzaviren oder RS(Respiratorische Synzytial)-Viren vor. Folgende Alarmsignale weisen auf eine schwere Erkrankung hin, in diesen Fällen sollten Eltern mit ihren Kindern gleich in die Arztpraxis:
- hörbare, rasselnde Atemgeräusche
- extrem starker Husten und Husten bis zum Erbrechen
- bläulich verfärbte Lippen und marmorierte Haut als Zeichen dafür, dass die Sauerstoffversorgung nicht ausreicht
- Einziehen der Haut zwischen den Rippen bei der Atmung
- Nasenflügelatmung, d. h., dass sich als Zeichen erschwerter Atmung die Nasenflügel mit bewegen
- schlechter Allgemeinzustand (Fieber, Schmerzen, Appetitlosigkeit)
Trockener, bellender Husten mit pfeifenden Atemgeräuschen ist ein Zeichen für einen Pseudokrupp-Anfall. Der Husten tritt dann ganz plötzlich und meist abends oder nachts auf. Die Ursache ist eine Kehlkopfentzündung durch Viren. An Pseudokrupp erkranken insbesondere Kinder zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Hustensaft hilft in diesen Fällen nichts. Das Kind sollte in eine aufrechte Position gebracht und beruhigt werden. Es hilft auch, die Fenster weit zu öffnen oder im Bad die Wasserhähne aufzudrehen, um so für eine hohe Luftfeuchtigkeit zu sorgen. Kommt es trotzdem zu einer starken Atemnot, muss das Kind in die Klinik oder der Notdienst gerufen werden. Meist braucht das Kind dann Kortison. Um für weitere Anfälle gerüstet zu sein, erhalten die Eltern Kortisonzäpfchen, die sie dem Kind bei Bedarfselbst verabreichen können.
Husten mit Hausmitteln eindämmen
Erkältungsbedingter Husten ohne Alarmsignale kann bei Kindern gut mit Hausmitteln und Hustensaft behandelt werden. Lindernd wirken folgende Maßnahmen:
- Luftfeuchtigkeit erhöhen. Trockene Luft reizt die Schleimhäute der Atemwege zusätzlichs. Deshalb sollte die Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen oder im Krankenzimmer höher sein als sonst. Dazu kann man Schüsseln mit warmem Wasser auf die Heizung stellen oder feuchte Tücher aufhängen.
- Brustkorb warmhalten. Wärme entspannt die Bronchialmuskulatur. Empfohlen werden spezielle Wickel aus Heilwolle oder Bienenwachs, die in der Apotheke erhältlich sind. Bei Säuglingen und Kleinkindern kann man diese Wickel und Auflagen auch gut zusätzlich mit einem engen Body fixieren.
- Heiße Milch mit Honig. Honig hat schleimlösende und entzündungshemmende Eigenschaften und lindert Husten. Für Kinder ab einem Jahr löst man 1-2 Teelöffel Honig in 220 ml (einer Tasse) warmer Milch auf, Kinder ab sechs Jahren bekommen einen Esslöffel Honig pro Tasse. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollte die Milch nur lauwarm sein. Aber Achtung: Honig enthält häufig Sporen des Bakteriums Clostridium botulimun. Im unausgereiften Darm von Säuglingen können die Sporen auskeimen und einen Säuglingsbotulismus hervorrufen. Kinder unter einem Jahr dürfen deshalb keinen Honig bekommen, auch nicht in geringer Menge in Milch aufgelöst.
- Hustenbalsam. Ätherische Öle erleichtern das Atmen und helfen dabei, den Schleim zu verflüssigen. Es gibt sie als spezielle Hustenbalsame, die man auf Brust und Rücken auftragen kann. Die leichte Massage entspannt die Kinder zusätzlich. Es sind aber nicht alle ätherischen Öle für Kinder geeignet . Eukalyptus, Menthol und Campher sind stark reizend und können u.a. zu Kehlkopfkrämpfen führen. Sie sollten bei Kindern unter sechs Jahren nicht angewendet werden. Besser geeignet sind Balsame mit Myrte, Zirbelkiefer und Thymian. Individuelle Beratung gibt es in der Apotheke oder bei der Kinderärzt*in.
- Hustenbonbons. Für Kinder, die schon kontrolliert lutschen können, sind auch Hustenbonbons eine Option. Sie beruhigen den Rachen und stillen dadurch den Hustenreiz. Manche Präparate beinhalten zudem Hyaluronsäure. Sie kleiden die Schleimhäute aus und wirken dadurch besonders angenehm – sind allerdings je nach Produkt erst für Kinder ab vier bzw. sechs Jahren geeignet. Welche Hustenbonbons für welches Alter in Frage kommen, erfährt man beim Beratungsgespräch in der Apotheke.
Pflanzliche Hustensäfte – effektiv und verträglich
Bei Kindern werden gerne pflanzliche Hustensäfte eingesetzt. Sie wirken auf unterschiedliche Arten schleimlösend und hustenlindernd. Deshalb können sie sowohl bei trockenem Reizhusten als auch bei produktivem Husten eingesetzt werden (also wenn die Kinder viel Schleim abhusten). Typische Inhaltsstoffe sind Efeu, Thymian, Eibisch und Isländisch Moos.
Thymian enthält ätherische Öle, die den Schleim lösen und das Abhusten erleichtern. In Efeu und in Primelblüten finden sich Saponine. Diese Stoffe verringern die Zähigkeit (Viskosität) des Schleims. Efeu enthält zudem Alpha-Hederin. Die Substanz weitet die Bronchien und erleichtert damit die Atmung. Extrakte aus Eibisch und Isländisch Moos enthalten Schleimstoffe, die sich im Rachen lindernd über die gereizte Schleimhaut legen.
Bei der Auswahl des passenden Hustensaftes gibt es einiges zu beachten. Deshalb ist es gut, sich von der Kinderärzt*in oder in der Apotheke individuell beraten zu lassen. Folgende Merkmale sind bei Hustensäften wichtig:
Altersempfehlung. Auch wenn es Präparate gibt, die schon ab der Geburt zugelassen sind: Zur Sicherheit sollten Säuglinge vor der Selbstmedikation mit einem Hustensaft ärztlich untersucht werden. Andere Säfte sind ab einem oder ab drei Jahren geeignet, Beratung dazu gibt´s in der Apotheke.
Frei von Alkohol. Weil Alkohol ein Nervengift ist, sollten insbesondere Kinder alkoholfreie Arzneimittel erhalten. Diese gibt es auch bei Hustensäften, allerdings sind auch mehrere alkoholhaltige Produkte zugelassen. In den Angaben zum Inhalt ist der Alkoholgehalt in Volumenprozent vermerkt. Der zugefügte Alkohol hat nichts mit der Wirkung des Saftes zu tun, er dient der besseren Löslichkeit der Substanzen und der Konservierung.
Konsistenz. Je dickflüssiger ein Hustensaft ist, desto besser bleibt er im Rachenraum „kleben“ und desto stärker ist dort seine Schutzwirkung. Sirupartige Hustensäfte sind deshalb besser als dünne, flüssige Präparate.
Geschmack. Vor allem bei Kindern ist es wichtig, dass der Hustensaft gut schmeckt. Deshalb hat auch das Kind bei der Auswahl ein Wörtchen mitzureden. Wer es lieber süß mag, freut sich über das Kirsch- oder Himbeeraroma mancher Säfte. Andere Kinder ziehen einen naturbelassenen Geschmack wie „krautig“ vor, für sie sind Säfte mit Thymiangeschmack zu haben.
Hinweis: Auch Hustensäfte müssen korrekt dosiert werden. Dafür ist den Präparaten in der Regel ein Messlöffel oder ein Messbecher beigefügt. Für kleinere Dosierungen – z.B. bei Säuglingen – sind jedoch Dosierpipetten besser. In manchen Hustensäften liegt eine solche Pipette bei. Ist dies nicht der Fall, bekommt man in der Apotheke eine kleine Spritze oder man erwirbt ein Set aus Kolbendosierpipette und Universalaufsatz.
Was tun bei trockenem Reizhusten?
Zu Beginn einer Erkältung ist der Husten oft trocken und quälend, vor allem nachts stört er beim Schlafen. Deshalb gibt es auch pflanzliche Hustensäfte, die vorwiegend reizlindernd als Hustenstiller dienen. Oder man greift zu synthetischen Hustenblockern (Antitussiva), die Reizhusten lindern. Frei erhältliche Wirkstoffe sind Pentoxyverin und Levodropropizin für Kinder ab zwei Jahren oder Dextromeorphan für Kinder ab sechs. Bei starkem Reizhusten kann die Ärzt*in Noscapin oder Dihydrocodein verschreiben.
Hinweis: Codein aus der Gruppe der Opiode ist zwar ein sehr effektiver Hustenstiller, für Kindern unter zwölf Jahren jedoch nicht geeignet . Bei ihnen kann der Wirkstoff sogar lebensgefährlich sein, weil er möglicherweise die Atmung reduziert.
Quellen: DAZ 2024, Nr. 3, S. 46

Mitesser und Pickel weg-pflegen
Bei leichter Akne und unreiner Haut
Die Akne ist mit ihren Pickeln und Mitessern eine weit verbreitete Hauterkrankung. Vor allem bei leichteren Fällen kann eine gezielte Hautpflege das Erscheinungsbild bessern. Tipps gibt es dafür viele, sie reichen von Peelings über Sonnenlicht bis zur Ernährung. Doch was ist hilfreich, und was schadet eher?
Unreine Haut plagt fast jeden einmal
Unreine Haut und die mildeste Form der Akne sind eng miteinander verwandt und ihre Übergänge fließend. Beide zeichnen sich durch vermehrte Talgproduktion und verstopfte Hautporen aus, die sich zu Mitessern und Pickeln auswachsen. Bei der leichten Form der Akne kommt es im Vergleich zur unreinen Haut häufiger zu entzündlichen Pusteln.
Ob unreine Haut oder milde Akne: In der Pubertät sind aufgrund der Hormonumstellung fast alle Jungen und Mädchen davon betroffen. Meist verschwinden die Hautprobleme danach wieder. Doch nicht bei allen: Etwa 20% der Erwachsenen leiden weiter an den typischen Symptomen, Frauen häufiger als Männer.
Oft werden die Hautprobleme als sehr belastend empfunden. Deshalb gibt es auch viele Ratschläge und noch mehr Lotionen, Gesichtswasser und Cremes, um die ungeliebten Pickel und Mitesser loszuwerden. Doch bei unreiner Haut und milder Akne hilft viel nicht viel: Im Gegenteil, eine zu intensive Pflege, womöglich auch mit immer wieder wechelnden Produkten, kann die Haut reizen und die Hautprobleme noch verstärken.
Hinweis: Die verschiedenen Akneformen unterscheiden sich in ihrer Ausprägung. Bei der milden Akne überwiegen Mitesser. Kommt es zu immer mehr entzündlichen Pickeln, die sich auch auf Brust und Rücken ausbreiten, handelt es sich um die mittelschwere und die schwere Form der Akne. Sie benötigen zusätzlich zur Hautpflege eine medikamentöse Therapie.
Grundlage: die Hautreinigung
Die zu Mitessern und Pickeln neigende Haut bedarf einer besonderen Pflege. Diese fängt mit der Reinigung an. Ihr Ziel ist, den übermäßig produzierten Talg zu entfernen. Gereinigt wird das Gesicht am besten dann, wenn sich die Haut fettig anfühlt. Das ist individuell unterschiedlich: Bei manchen Betroffenen reicht die abendliche Hautreinigung, für andere ist es besser, dies morgens und abends zu tun. Übermäßiges Waschen ist ungünstig, denn dadurch wird die Haut ausgetrocknet und gereizt.
Nicht nur die Häufigkeit des Waschens, auch das Reinigungsmittel muss an die unreine Haut angepasst werden. Normale Seifen sind dafür ungeeignet. Sie haben einen hohen pH-Wert, wodurch sie die Haut irritieren und Entzündungen begünstigen können. Empfohlen werden deshalb seifenfreie Produkte mit einem der Haut angepassten pH-Wert von 5,5. Wichtig: Das Produkt sollte nicht parfümiert sein, denn Duftstoffe können die empfindliche Haut ebenfalls reizen.
In der Apotheke sind spezielle, unparfümierte Reinigungsgele erhältlich. Sie enthalten neben passenden waschaktiven Substanzen zusätzliche Wirkstoffe wie Salicylsäure oder Zink. Zink mattiert die Haut, und Salicylsäure fördert die Abschuppung abgestorbener Zellen.
Hinweis: Junge Männer mit unreiner Haut oder Akne haben noch ein zusätzliches Problem: den Bartwuchs. Es gibt allerdings kaum Untersuchungen darüber, welche Rasur am besten für die ohnehin gereizte Haut ist. Ob nass oder trocken, Expert*innen zufolge ist beides erlaubt. Viel wichtiger ist es, bei der Rasur besonders vorsichtig zu sein und die Haut nicht zu verletzen.
Mit Peelings die Pickel wegschrubben?
Viele Betroffene mit unreiner Haut haben das Bedürfnis, die Pickel und Mitesser regelrecht abzuschrubben. Tatsächlich kann man mit einem Peeling zwar nicht die Pickel, aber die abgestorbenen Hautschuppen entfernen. Auch das bessert das Hautbild langfristig oft deutlich.
Für die Aknehaut werden allerdings nur chemische Peelings mit Milchsäure oder Salicylsäure empfohlen. Sie fördern das Abfließen des Talgs und wirken dadurch der Bildung von Pickeln entgegen. Man sollte sie zunächst nur einmal wöchentlich anwenden. Wird das gut vertragen, kann man auf zwei Peelings pro Woche steigern. Nicht gepeelt werden darf die Haut bei starker Entzündung und ausgeprägten Eiterpickeln. Denn durch das Peeling wird die schon entzündete Haut nur weiter gereizt.
Hinweis: Von mechanischen Peelings mit Partikeln aus Kunststoff, Salzen oder Sand wird dagegen prinzipiell abgeraten. Zu groß ist die Gefahr, dass es dabei zu Mikroverletzungen und Entzündungen in der Haut kommt.
Ausdrücken oder nicht?
Pickel im Gesicht fordern geradezu auf, ausgedrückt zu werden. Vor allem bei Eiterpickeln fällt die Stelle danach etwas weniger ins Auge. Trotzdem sollte man an Pickeln nicht herummanipulieren. Denn durch den Druck kann der Eiter tiefer in die Haut gelangen und dort zu weiteren Entzündungen führen. Auch das Ausdrücken von Mitessern ist wenig erfolgversprechend. Meist gelingt es nicht vollständig, eher kommt es durch das Herumdrücken noch zu einer zusätzlichen Infektion.
Hygienischer und effektiver ist es, sich die Pickel in einem medizinischen Kosmetikstudio oder bei der Hautärzt*in professionell öffnen zu lassen. Dazu wird die Haut meist mit Dampf oder warmen Kompressen vorbereitet. Nach Weitung der Poren können die Pickel geöffnet und ausgedrückt und Mitesser entfernt werden. Oft benutzt man dazu auch spezielle Instrumente.
Hinweis: Pickel an der Nase oder an der Oberlippe darf man auf keinen Fall ausdrücken. Durch das Herumquetschen können Bakterien in die Blutbahn gelangen und über eine Verbindung zwischen den Gesichts- und Gehirnvenen das Gehirn erreichen. In der Folge droht eine lebensgefährliche Infektion.
Hautpflege im Pickelgebiet
Nach der Reinigung sollte die Haut gut gepflegt werden. Empfohlen werden leichte Öl-in-Wasser-Emulsionen, denn fetthaltige Salben auf Vaseline- oder Mineralölbasis verstopfen die Poren zusätzlich. Unreine Haut benötigt zudem viel Feuchtigkeit, deshalb sind feuchtigkeitsspeichernde Gele günstig.
Spezielle Präparate enthalten auch lipidhaltige Formulierungen. Dabei handelt es sich um komplexe biologische Moleküle, die den natürlichen Hautfetten ähneln. Sie verstopfen die Poren nicht, können aber tiefer in die Haut eindringen als die ölhaltige Fette und deshalb die Hautbarriere stärken.
Manchmal wird zur Pflege auch Benzoylperoxid empfohlen. Es wirkt antientzündlich und löst Mitesser auf. Außerdem setzt es in der Haut Sauerstoff frei und schädigt dadurch eventuell vorhanden Bakterien. Man sollte allerdings wissen, dass es zu Beginn der Anwendung zu einer vorübergehenden Verschlimmerung der Hauterscheinungen kommen kann. Benzoylperoxid steht als Gel, Creme und Lotion zur Verfügung und wird – je nach Packungsbeilage! –zweimal täglich dünn auf die befallenen Areale aufgetragen.
Hinweis: Benzoylperoxid hat eine bleichende Wirkung. Wimpern, Augenbrauen und Kleidung sollten deshalb damit nicht in Berührung kommen.
Pickel abdecken – aber wie?
Für das Abdecken von Pickeln und Mitessern gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ob Make-up, Puder oder Abdeckstifte, die Produkte dürfen nicht fetthaltig sein. Ansonsten können sie die Poren verstopfen und das Hautbild verschlechtern.
Auf dem Markt gibt es spezielle Serien, die für unreine oder Aknehaut besonders geeignet sind. Eine gute Auswahl und Beratung erhält man in der Apotheke. Auch die Hautärzt*in kann weiterhelfen.
Manchmal werden verschiedene Inhaltsstoffe der Präparate nicht gut vertragen. Die Haut rötet sich oder entstehen noch mehr Pickel. Dann sollte man das Produkt wechseln. Mit der Zeit findet man so selbst heraus, welches Make-up am besten vertragen wird.
Tipp: Einzelne Pickel lassen sich auch mit speziellen durchsichtigen Pickelpflastern abkleben, über die man Make-up oder Puder aufträgt. In vielen Fällen sind die Pickel dann kaum noch zu erkennen.
Sonne und Ernährung
Es kursieren viele Theorien darüber, was der Grund für Pickel ist – und genausoviele Ratschläge, wie man die Pickel los wird. Die wenigsten davon stimmen. Unfug sind zum Beispiel die Behauptungen, ausgiebiges Masturbieren, fettes Essen oder mangelnde Hygiene könnten dafür verantwortlich sein.
Hartnäckig halten sich auch Theorien, nach denen UV-Licht und Kohlenhydrate einen Einfluss auf Pickel und Hautunreinheiten haben . Der aktuelle Kenntnisstand dazu ist folgender:
- UV-Licht: Manche Expert*innen glauben, dass Sonne und Solarium die Haut bei Akne verbessert, andere nehmen das Gegenteil an. Wissenschaftlich bewiesen ist eine günstige Wirkung von UV-Strahlung bisher nicht. Klar ist allerdings, dass die Haut unter zu viel Sonne oder Solarium leidet. Und dass sich Menschen mit Akne genauso vor Sonnenbrand schützen müssen wie Menschen ohne Hautprobleme. Dafür gibt es in der Apotheke spezielle Sonnencremes, die UV-Strahlung filtern ohne die Haut zusätzlich zu belasten oder Unreinheiten zu fördern.
- Ernährung. Ähnlich widersprüchlich sind die Einschätzungen, ob spezielle Nahrungsmittel eine unreine Haut fördern. Bewiesen ist ein schädlicher Einfluss bisher nicht – auch nicht bei der oft angeschuldigten Schokolade. Viel diskutiert wird aktuell, dass eine besonders kohlenhydrathaltige Ernährung zur Entstehung von Akne beiträgt. Vor allem stark zuckerhaltige Lebensmittel stehen unter Verdacht. Gleiches wird auch von Milch und Fleisch behauptet. Ob sich das Hautbild bei Verzicht auf diese Nahrungsmittel bessert, konnte mit Studien noch nicht geklärt werden.
All diese Vermutungen haben dazu geführt, dass Betroffene zusätzlich verunsichert werden und bei sich selbst die Schuld für ihre Hautprobleme suchen. Etwa weil sie zu viel Schokolade essen oder zu wenig in der Sonne sind. Manche Betroffene vermeiden auch grundlos Speisen, die ihnen schmecken, und vermindern dadurch ihre Lebensqualität weiter. Das ist grundfalsch. Menschen mit unreiner Haut oder Akne können nichts für ihre Erkrankung. Akne entsteht nicht durch eine schlechte Ernährung oder eine mangelhafte Hygiene. Die Ursache der Hautprobleme sind vor allem Hormone und hormonelle Umstellungen, durch die die Haut zu einer vermehrten Produktion von Talg angeregt wird.
Hinweis: Unreine Haut und Akne können schwer auf die Psyche drücken und zu Depressionen führen. Wer aufgrund seiner Hautprobleme nicht mehr zurecht kommt, sollte sich psychologische Unterstützung suchen. Dabei helfen psychosoziale Beratungsstellen und die Telefonseelsorge.
Wenn gar nichts hilft…
Zum Glück lassen sich unreine Haut und milde Akne durch eine entsprechende Hautpflege oft gut in den Griff bekommen. Zudem erledigt sich das Problem bei den meisten Betroffenen nach Abschluss der Pubertät von selbst.
In manchen Fällen weiten sich die Hautproblemen aber auch aus. Es kommt zu immer mehr Entzündungen, die auch an Brust und Rücken aufblühen. Manchmal entwickeln sich einzelne Eiterpickel zu Knoten und Zysten und lassen nach dem Abheilen Aknenarben zurück.
In diesen Fällen ist eine entsprechende Hautpflege zwar Basis der Behandlung, reicht aber nicht aus. Dann kommen zusätzliche Medikamente ins Spiel, die ärztlich verordnet werden müssen. Dazu gehören Antibiotika als Creme zum Auftragen und als Tabletten zum Einnehmen, oft wird auch Azelainsäure zum Eincremen empfohlen.
Bleibt diese Behandlung erfolglos, sind Retinoide wie Isotretinoin eine Option. Die Substanz reduziert die Talgproduktion und wirkt gleichzeitig entzündungshemmend. Zu Beginn der Behandlung kann es zu einer Verschlechterung der Haut kommen, später bessert sich das Hautbild oft erheblich.
Hinweis: Retinoide dürfen keinesfalls von Schwangeren oder gebärfähigen Frauen, die nicht verhüten, eingenommen werden. Sie verursachen schwerwiegende Fehlbildungen und neurologische Schäden beim Ungeborenen. Am kritischsten ist die Zeit im ersten Schwangerschaftsdrittel.

Heiß und kalt gegen den Schmerz
Therapeutische Temperaturreize
Wärme und Kälte werden schon seit Jahrhunderten zur Behandlung von Schmerzen, Verletzungen und entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Inzwischen weiß man auch, dass Anwendungen wie Sauna und Kältekappen sogar vorbeugend wirken können. Doch was passiert dabei im Körper, welche Erkrankungen lassen sich damit behandeln und wann muss man mit extremen Temperaturreizen aufpassen?
Therapie mit Tradition
Unsere Vorfahren kannten sich mit der therapeutischen Wirkung von Wärme gut aus: Archäologische Funde belegen zum Beispiel, dass wärmende Kirschkernkissen schon vor dem 15. Jahrhundert genutzt wurden. Im alten Ägypten nahm man heiße Steine und Sandsäcke, um Schmerzen zu lindern. Die römischen Thermen waren berühmt für ihre Heilwirkung durch heißes Wasser und heiße Dämpfe. Und eine bestimmte Form der Wärmetherapie, das Moxa-Brennen, wird seit Jahrtausenden in der traditionellen chinesischen Medizin praktiziert.
Ähnlich sieht es mit Kälteanwendungen aus: Medizinische Texte aus der Zeit vor Christi Geburt dokumentieren Kältebehandlungen bei Verletzungen. Auch Hippokrates und Galen empfahlen Eis und kaltes Wasser für die Therapie von Prellungen und Entzündungen. Arabische Ärzte wie Avicenna propagierten im Mittelalter kalte Umschläge gegen Fieber.
Wärme- und Kälteanwendungen konnten auch durch die moderne Medizin nicht verdrängt werden. Sie sind auch heute ein wichtiger Bestandteil von Behandlungen. Im Rahmen der physikalischen Therapie werden Temperaturreize sowohl in traditioneller Weise, aber auch in neuen Anwendungsarten wie z.B. Kältekammern erfolgreich eingesetzt.
TRP-Kanäle reagieren auf Kälte und Wärme
Früher beruhte der Einsatz von Kälte und Wärme gegen Schmerzen auf Erfahrungsmedizin, also auf Beobachtungen von Patient*innen, die damit behandelt werden. Seit Kurzem verstehen Forschende jedoch genauer, warum Wärmepflaster oder Coolpacks schmerzlindernd wirken: In der Haut befinden sich Nervenfasern mit temperaturempfindlichen Rezeptorkanälen (TRP-Kanäle). Sie reagieren auf definierte Temperaturveränderungen. Durch ihre Reaktion werden verschiedene Vorgänge im Körper angestoßen.
Wärme aktiviert insgesamte vier TRP-Kanäle. Einer davon wird auch durch Capsaicin, einem Inhaltsstoff der Paprika angeregt. Die Aktivierung dieser Kanäle an den Nervenendigungen in der Haut löst drei Mechanismen aus:
- Es kommt zur Stimulation von Nervenzentren im Gehirn, die wiederum schmerzlindernde Nervenbahnen im Rückenmark beeinflussen. Dadurch wird der Schmerz abgeschwächt.
- Wo Pflaster oder Wärmekissen aufliegen, steigt die Temperatur im Gewebe. Dadurch wird die Durchblutung verbessert, was wiederum den Stoffwechsel ankurbelt und Heilungsprozesse beschleunigt.
- Die Wärme macht auch das Bindegewebe elastischer. So erklärt man sich, dass Wärme die Beweglichkeit bei schmerzender Muskel- und Gelenksteifigkeit verbessert.
Auch für die Kälte gibt es TRP-Kanäle an den Nervenfasern. Zwei wurden bisher identifiziert: TRPA1 übermittelt bei Hauttemperaturen (nicht Außentemperaturen!) unter 17° C Signale an das Gehirn und ist damit an der Wahrnehmung extremer Kälte beteiligt. TRPM8 wird bei einer Hauttemperatur von 25-27° C aktiviert – und durch chemische Substanzen wie Menthol. Nach Aktivierung von Kältekanälen kommt es zu folgenden Reaktionen:
- Schmerzleitende Signale werden abgeschwächt, das Schmerzempfinden deshalb vermindert.
- Der Transkriptionsfaktor Nrf2 wird aktiviert. Dieses Protein reguliert bestimmte Gene in den Zellen und spielt eine Rolle bei entzündungshemmenden und zellschützenden Prozessen.
- Durch das Sinken der Gewebetemperatur wird die Durchblutung gedrosselt. Dadurch gelangen weniger entzündungsfördernde Enzyme und Hormone in das Gewebe, Entzündungen werden dadurch gemildert.
Hinweis: Entdeckt wurden die TRP-Kanäle vom US-amerikanischen Sinnesphysiologen Prof. Dr. David Julius. Er hielt dafür im Jahr 2021 den Nobelpreis für Medizin.
Wo kommt Wärme zum Einsatz?
Wärme wird auf zweierlei Weise angewendet. Tradition hat die lokale Therapie, also die direkte Anwendung auf der Haut. Dies geschieht mithilfe von
- Wärmeflaschen, elektrischen Wärmekissen oder in der Mikrowelle (früher auf dem Ofen) aufgeheizten Kirschkernkissen
- Rotlicht und Fangopackungen
- Wärmekompressen oder Wärmepflaster auf chemischer Basis, ohne spezielle Wirkstoffe
- Wärmepflaster oder Wärmecremes/-salben mit speziellen Wirkstoffen wie Capsaicin, dem Capsaicin-Analogon Nonivamid oder gefäßerweiternden Substanzen (z.B.) Nicoboxil
Eine solche lokale Wärmetherapie ist bei verschiedenen Erkrankungen wirksam. Dazu gehört die Behandlung von Muskelkater und Rückenschmerzen, aber auch die Vorbeugung von nächtlichen Wadenkrämpfen. Ein weiteres Einsatzgebiet lokaler Wärme sind Schmerzen und Krämpfe im Rahmen der Menstruation. Dabei soll die Wärme auf Bauch und Unterleib ähnlich wirksam sein wie Schmerztabletten. Das beruht nicht nur auf einer Beseitigung von Muskelverspannungen. Die Wärme fördert auch die Durchblutung des Beckens. Dadurch werden Körperflüssigkeiten und Blut besser abtransportiert und der Druck auf Nervenbahnen im Becken nimmt ab.
Wärme kann außerdem bei der rheumatoiden Arthritis die Gewebeelastizität verbessern und dadurch die Gelenksteifigkeit reduzieren. Hierbei ist jedoch unbedingt zu beachten, dass Wärme nur in entzündungsfreien Phasen der Erkrankung angewendet wird. Ist die Krankheit aktiv, schadet Wärme. Denn durch die verbesserte Durchblutung wird die Entzündung weiter angetrieben.
Doch nicht nur lokale Wärme hat positive Wirkungen. Wird der ganze Körper in der Sauna aufgeheizt, wird das Herz-Kreislauf-System trainiert. Dadurch lernt der Körper, besser mit Hitze fertig zu werden. Außerdem reagiert er auf zellulärer Ebene schneller auf extreme Reize. Insgesamt werden antioxidative, entzündungshemmende und zellschützende Prozesse angestoßen. Infolgedessen verbessert sich die Funktion der Gefäßinnenhaut und das Risiko für Atemwegsinfekte sinkt.
Für manche Menschen ist Wärme als Therapie allerdings nicht geeignet. Patient*innen mit Diabetes mellitus leiden z. B. häufig an Nerven- oder Durchblutungsstörungen. Sie müssen mit Wärme besonders vorsichtig umgehen: Eine zu heiß befüllte Wärmeflasche kann bei gestörtem Schmerz- oder Temperaturempfinden leicht zu Verbrennungen führen. Gleiches gilt für Menschen, die aufgrund einer anderen Ursache an einer Nervenstörung leiden. Auch das Saunieren wird in einigen Situationen nicht empfohlen. Das gilt für Personen mit instabiler Angina pectoris, fiebriger Erkrankung oder verminderter Schweißbildung, aber auch für Patient*innen nach einem Herzinfarkt.
Hinweis: Wärmepflaster- und cremes mit und ohne pharmakologische Inhaltsstoffe sind in der Apotheke zu haben. Dort erhält man auch eine ausführliche Beratung, welche Form der Wärmeapplikation für die jeweiligen Beschwerden am besten geeignet ist.
Was Kälte alles kann
Die Kältetherapie hat ebenfalls seit je her zahlreiche Einsatzgebiete. Dazu gehören insbesondere
- Akute Verletzungen wie Zerrungen und Prellungen. Durch die kältebedingte Verringerung der Durchblutung werden Schwellungen und Schmerzen reduziert.
- Rheumatische Erkrankungen. Kälte führt im akuten, entzündlichen Stadium zu einem Rückgang der entzündlichen Reaktion und zu einer Verminderung von Gelenkschwellungen.
- Schmerztherapie. Durch Verringerung der Durchblutung wird die Ansammlung von schmerzauslösenden Substanzen im Gewebe vermindert. Außerdem verlangsamt Kälte die Weiterleitung von Schmerzimpulsen entlang der Nervenbahnen.
- Regeneration beim Sport. Kälteanwendungen können die Intensität und die Dauer von Muskelkater verringern.
Zum Kühlen gibt es neben dem klassischen Eiswürfelbeutel auch Sprays, Eislollys, Kältekompressen und Kühlgele.
Kältespray wird insbesondere bei Sportverletzungen, Prellungen und Verstauchungen eingesetzt. Dazu sprüht man es aus mindestens 20 cm Entfernung auf die Haut. Zu beachten ist dabei, dass zu langes Sprayen zu Erfrierungen führen kann.
Eislollys kommen vor allem bei Sehnenansatzschmerzen und in der Sportmedizin zum Einsatz. Man kann sie mit einem Joghurtbecher, Wasser und einem Holzspatel selbst herstellen. Sie werden mit kreisenden Bewegungen auf dem betroffenen Areal bewegt, wobei das Schmelzwasser kontinuierlich mit einem Handtuch aufzunehmen ist.
Kältekompressen helfen besonders gut bei Insektenstichen, stumpfen Verletzungen, Zahnschmerzen oder akuten Muskel- und Gelenkentzündungen. Es gibt sie als Gelkompressen (oder Cool-Packs), die im Eisfach gelagert und bei Bedarf auf die betroffene Stelle gelegt werden. Chemische Kompressen kühlen, nachdem der Innenbeutel durch Druck zum Platzen gebracht wurde. Für beide Arten gilt: Immer ein Tuch zwischen Haut und Kompresse legen, denn ein direkter Hautkontakt mit der konstanten Kälte kann zu Erfrierungen führen. Außerdem sollte in Intervallen, also nicht permanent gekühlt werden.
Kühlgel mit Menthol oder Alkohol erfrischt müde Füße, Arme und Beine. Es wird auf die Haut aufgetragen und leicht einmassiert. Für Kinder unter sechs Jahren sind solche Kühlgele nicht geeignet, weil sie die empfindliche Haut reizen. Schwangere sollte vor allem mentholhaltige Gele meiden. Das ätherische Öl kann vorzeitige Wehen auslösen.
Eine relativ neue Art der lokalen, also örtlichen Kälteanwendung ist die Kältekappe. Sie soll gegen den durch Chemotherapie ausgelösten Haarausfall helfen. Denn die Chemotherapie wirkt besonders auf Zellen, die sich schnell teilen: und das sind neben den Krebszellen auch die Haarfollikelzellen. Bei dieser vorbeugenden Therapie wird die Kopfhaut während der Chemo mit einer Spezialkappe gekühlt, in der -4° C kalte Flüssigkeit zirkuliert. Die Haarfollikelzellen fahren aufgrund der kältebedingt verringerten Hautdurchblutung ihren Stoffwechsel herunter und sind deshalb weniger anfällig für die Chemotherapeutika. In Studien mit Brustkrebspatientinnen konnte die Kältekappe bei der Hälfte der Frauen den Haarverlust auf weniger als 50% verringern. An einigen Kliniken wird dieses Scalp-Cooling bereits eingesetzt. Unklar ist allerdings noch, ob die herabgekühlte Kopfhaut nicht auch zirkulierende Tumorzellen schützt, die später zu einer Metastasierung führen könnten.
Neben den verschiedenen örtlichen Kälteanwendungen wird auch die Ganzkörper-Kältetherapie immer populärer. Dafür setzt man den Organismus in Kältekammern für wenige Minuten Temperaturen unter -100° C aus. Eine Alternative zu den Kammern ist das Eintauchen des Körpers bis zum Brustbein in 4° C kaltes Wasser. Von dieser Kältebehandlung verspricht man sich den Rückgang von Entzündungen und Schmerzen sowie eine bessere Regeneration nach sportlicher Belastung.
Nachgewiesen sind positive Effekte auf die rheumatoide Arthritis und auf die Fibromyalgie. Daneben soll der Kälteschock auch Psyche und Wohlbefinden verbessern, auf das Immunsystem wirken und das Körperfettgewebe beeinflussen. Wie die Ganzkörperkältetherapie wirkt, ist noch nicht völlig geklärt. Diskutiert werden u.a. die Freisetzung von Noradrenalin, die Abnahme entzündungsfördernder Botenstoffen und die Verlangsamung von Stoffwechselaktivitäten.
Hinweis: Genauso wie die Sauna ist auch die Ganzkörper-Kältetherapie nicht für alle Menschen geeignet. Weil dabei Blutdruck, Herz- und Atemfrequenz steigen, sollten Patient*innen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor solchen Kälteanwendungen immer ihre Ärzt*in konsultieren.
Quellen: Esch J, DAZ 2024; 15: 42; Morvilius S, Erfahrungsheilkunde 2022: 3: 153-157

Hochbetagte gut ernähren!
Mit Fingerfood und Supplementen
Im Alter gibt es etliche Gründe, warum es zu einer Mangelernährung kommen kann. Sie reichen vom natürlichen Schwächerwerden der Organe über Nebenwirkungen von Medikamenten bis hin zu ungünstigen Lebensumständen. Vor allem Hochbetagte nehmen oft zu wenig Energie und Nährstoffe auf. Doch mit genügend Flüssigkeit und einer ausreichenden Zufuhr von Proteinen, Vitaminen und Kalzium lässt sich ernährungsbedingten Mangelerscheinungen vorbeugen.
Altern geht auf Darm und Nieren
Das Alter ist heute kein kurzer Lebensabschnitt mehr. Im Gegenteil - Menschen in Deutschland werden immer älter. Während die Lebenserwartung für 1950 geborene Jungen und Mädchen noch bei knapp 65 bzw. 69 Jahren lag, beträgt sie für 2022 geborene Kinder 78 bzw. 83 Jahre. Das bedeutet, dass immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichen – das definitionsgemäß mit 75 Jahren anfängt.
In diesem Alter gesund und leistungsfähig zu bleiben, ist nicht selbstverständlich. Denn der Organismus verändert sich mit den Jahren. Von den physiologischen, also natürlichen Alterungsprozessen, sind nahezu alle Organsysteme und Gewebe betroffen. Muskelmasse, Knochenmasse und die Menge an Körperwasser nehmen ab. Im Gegenzug erhöht sich der Fettanteil, vor allem das Eingeweidefett, das sich im Bauch rund um die Organe herum befindet. Die Organe selbst werden durch eine geringere Durchblutung und Alterungsprozesse kleiner und büßen an Leistung ein.
Das zeigt sich besonders deutlich an der Niere: Sie kann im Alter nicht nur Fremd- oder Giftstoffe schlechter ausscheiden. Zudem findet ein wichtiger Schritt zur Aktivierung von Vitamin D oft nicht mehr so gut statt. Dann kommt es zu Vitamin-D-Mangel und Knochenbrüchigkeit. Auch der hochbetagte Darm arbeitet nicht mehr so gut wie in jungen Jahren. Die Zellerneuerung der Darmschleimhaut dauert länger, wodurch die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen vermindert ist. Die geringere Nervensensibilität im Enddarm begünstigt zudem die Verstopfung.
Ältere Menschen essen außerdem oft einfach weniger, weil sie weniger Appetit haben. Dahinter stecken ein abnehmender Geschmacks- und Geruchssinn und ein schnelleres Sättigungsgefühl – verursacht dadurch, dass sich der alte Magen weniger gut dehnen kann. Auch das Durstempfinden sinkt mit dem Alter.
Hinweis: Viele Hochbetagte haben Probleme mit dem Kauen, sei es durch schadhafte Zähne oder eine schlecht sitzende Zahnprothese. Auch deswegen nehmen sie oft weniger Kalorien und Nährstoffe auf. Um dem entgegenzusteuern, ist es auch im vorgerückten Alter wichtig, regelmäßig die Zahnärzt*in aufzusuchen.
Medikamente und Einsamkeit als Appetitkiller
Neben diesen natürlichen Alterungsvorgängen gibt es noch einen entscheidenden weiteren Faktor für eine gestörte Aufnahme von Nährstoffen: Alte Menschen leiden vermehrt unter chronischen Erkrankungen und benötigen häufig eine große Anzahl von Medikamenten. Von etlichen Wirkstoffen ist jedoch bekannt, dass sie die Aufnahme von Mengen- oder Spurenelementen behindern. Beispiele sind
- Protonenpumpenhemmer (PPI). Diese bei Gastritis oder Magenulkus eingesetzten Wirkstoffe verringern die Aufnahme von Mikronährstoffen über die Darmschleimhaut.
- Antidepressiva, Anticholinergika, Promethazin. Diese Wirkstoffe lösen eine Trockenheit im Mund aus und bewirken dadurch häufig, dass alte Menschen weniger essen.
- Herzglykoside und nichtsteroidale Antirheumatika. Sie führen oft zu Übelkeit, Bauchschmerzen und Verstopfung und schränken damit den Appetit ein.
- Entwässerungsmittel. Diuretika sind harntreibend und können eine vermehrte Ausscheidung der wichtigen Nährstoffe Zink, Magnesium oder Kalium verursachen.
- Statine zur Cholesterinsenkung. Diese Medikamente hemmen in der Leber die Synthese von Coenzym Q10.
Hinweis: Auch die Psyche hat einen Einfluss auf den Ernährungszustand. Einsamkeit und Depressionen können dazu führen, dass die Lust am Essen verloren geht.
Wozu führt Mangelernährung und wie häufig ist sie?
All die genannten Prozesse können zu einer Mangelernährung führen. Dabei lassen sich zwei Formen unterscheiden, die jedoch in vielen Fällen auch kombiniert auftreten:
Bei der quantitativen Mangelernährung bekommt der Organismus nicht genügend Energie, d.h. die Kalorienzufuhr ist langfristig geringer als der Kalorienbedarf. Typisches Anzeichen dafür ist die Gewichtsabnahme.
Von einer qualitativen Mangelernährung spricht man, wenn der Mensch nicht genügend Eiweiß, Vitamine und Mengen- oder Spurenelemente aufnimmt – das kann sogar bei Übergewicht der Fall sein.
Eine zu geringe Aufnahme von Energie und Nährstoffen kann zahlreiche Folgen haben. Müdigkeit und Antriebslosigkeit gehören ebenso dazu wie körperliche Schwäche und Störungen beim Denken und Konzentrieren. Häufig ist die Mangelernährung auch mit einer zu geringen Aufnahme von Flüssigkeit verbunden und es kommt zur Austrocknung des Körpers. Eine solche Dehydratation macht sich durch trockene Haut und Schleimhäute, eine rissige Zunge und Schwindel beim Aufstehen bemerkbar.
Auch ganz spezielle Folgen drohen. Bei einem Mangel an Vitamin D und/oder Kalzium entwickelt sich leicht eine Osteoporose und das Risiko für Knochenbrüche steigt. Eine zu geringe Versorgung mit Vitamin B12 und Folsäure führt zu einer Anämie, was die Antriebsschwäche zusätzlich verstärkt. Nährstoffmangel stört zudem die Wundheilung und erhöht die Gefahr für das Wundliegen (Dekubitus).
Hinweis: Mangelernährung im Alter ist häufig. In einer Untersuchung an über 2000 Pflegeheimbewohner*innen wiesen knapp 17% einen Body Mass Index unter 20 auf und waren damit nach WHO-Definition für Senior*innen über 65 Jahren untergewichtig.
Mangelernährung vorbeugen – so geht´s
Mit steigendem Alter nimmt das Risiko für eine Mangelernährung zu. Ist ein alter Mensch quantitativ mangelernährt, also untergewichtig, ist es sehr schwer, wieder Gewicht aufzubauen. Diesem Zustand sollte frühzeitig aktiv entgegengesteuert werden. Dabei muss nicht nur auf ausreichend Energie in Form von Kalorien, sondern auch auf die Nährstoffe geachtet werden.
Kalorien. Der Energiebedarf von Senior*innen ist geringer als bei jüngeren Erwachsenen. Bei wenig Bewegung benötigen Frauen etwa 1700 Kilokalorien täglich und Männer 2100. Die Ernährung soll an diesen Bedarf angepasst und bei Untergewicht patientenverträglich erhöht werden. Basis ist eine gesunde abwechslungsreiche Mischkost, die ausreichend Nährstoffe und Eiweiß beinhaltet.
Eiweiß. Für Männer und Frauen über 65 Jahren empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) die tägliche Aufnahme von 1 bis 1,2 g Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Wurde schon eine Sarkopenie, also ein verstärkter Muskelabbau, diagnostiziert, sind sogar 1,2 bis 1,5 g pro kgKG erforderlich. Um diese Menge gut aufzunehmen, sollte das Eiweiß über drei Hauptmahlzeiten hinweg verteilt werden. Eiweißreich sind neben Fleisch und Milchprodukten auch Eier, Lachs, Thunfisch auch Tofu, Quinoa, Brokkoli und Spinat.
Flüssigkeit. Ältere Erwachsene sollten über Getränke und Nahrung etwa 1,5 l Flüssigkeit zu sich nehmen. Neben Wasser, ungesüßtem Tee oder Kaffee sind dafür Gemüsesuppen und wasserhaltiges Obst gut geeignet. Bei Herz- oder Nierenerkrankungen muss die aufgenommene Flüssigkeitsmenge entsprechend angepasst werden.
Hinweis: Beim Vorliegen oder Drohen einer Mangelernährung sollte die behandelnde Ärzt*in immer die eingenommenen Medikamente überprüfen. Manche Wirkstoffe lassen sich durch andere, mit weniger Nebenwirkungen behaftete Substanzen ersetzen.
Auf kritische Nährstoffe achten
Energie, Eiweiß und Flüssigkeit sind nur ein Teil einer gesunden Ernährung im Alter. Wichtig ist zudem, ausreichend Nährstoffe aufzunehmen. Dies ist mit einer gesunden, ausgewogenen Kost aus nährstoffdichten Lebensmitteln recht gut zu bewerkstelligen. Es gibt allerdings drei Komponenten, die bei Hochbetagten zu den sogenannten kritischen Nährstoffen gehören und auf die besonders zu achten ist - Vitamin D, Kalzium und Vitamin B12.
Vitamin D. Bei alten Menschen ist ein Vitamin-D-Mangel sehr wahrscheinlich. Das liegt daran, dass die Haut weniger Prävitamin D produziert und die Niere diese Vorstufen weniger gut aktivieren kann. Deshalb wird alten und hochbetagten Menschen empfohlen, neben ihrer gesunden Ernährung Vitamin-D-Präparate einzunehmen. Die entsprechende Dosis sind 20 Mikrogramm am Tag.
Kalzium. Um Knochen und Muskeln zu stärken, sind zusätzlich 1000 mg Kalzium nötig. Diese Menge kann man aus kalziumreichen Mineralwässern, Milchprodukten und oxalarmen Gemüse wie Brokkoli beziehen. Für eine ausreichende Kalziumaufnahme von etwa 1050 mg reicht z.B. der tägliche Verzehr von 150 ml Milch oder Buttermilch plus 150 g Joghurt plus 50 g Emmentaler Käse aus. Ist dies nicht möglich, kann Kalzium auch zusätzlich als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden.
Vitamin B12. Desweiteren empfiehlt die DGE älteren Menschen, regelmäßig ihren Vitamin B12-Status kontrollieren zu lassen. Denn ein Vitamin-B12-Mangel lässt die Blutspiegel von Homocystein ansteigen, was das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall sowie für venöse Thrombosen erhöht. Außerdem begünstigt ein Vitamin-B12-Mangel Anämien und Nervenstörungen. Liegt ein Mangel vor, muss dieser unter ärztlicher Aufsicht beseitigt werden. Das gelingt mit Tabletten oder über intramuskuläre Injektionen, die jeweilige Dosierung ist individuell anzupassen. Immer soll B12 zugeführt werden, wenn gleichzeitig Protonenpumpenhemmer eingenommen werden. Das Gleiche gilt bei veganer bzw. vegetarischer Ernährung.
Hinweis: In Einzelfällen können durch eine reduzierte Nahrungsaufnahme oder einseitige Ernährung auch Mineralstoffe wie Zink, Eisen, Jod oder Selen verringert sein. Bei entsprechenden beschwerden ist es jedoch vor einer Ergänzung mit Nahrungsergänzungsmitteln sinnvoll, einen Mangel von der Ärzt*in durch Blutuntersuchungen nachweisen zu lassen.
Allgemeine Tipps für mehr Lust am Essen
Unabhängig von altersbedingten Veränderungen des Organismus und der Medikamenteneinnahme haben Hochbetagte oft weniger Lust, zu essen. Hier können einige Tipps helfen:
- abwechslungsreiches, appetitanregendes Essen anbieten, Wunschkost erfüllen
- neben den drei Hauptmahlzeiten mindestens zwei energie-/proteinreiche Zwischenmahlzeiten anbieten, z.B. Joghurt oder Käsewürfel
- für aufrechte Haltung sorgen, möglichst im Sitzen essen lassen
- gemeinsam mit Familienmitgliedern essen
- für entspannte Atmosphäre beim Essen sorgen, Zeitdruck vermeiden
- geeignete Hilfsmittel einsetzen (Schnabeltasse, Unterstützung beim Schneiden)
- regelmäßig Zähne und Prothesen kontrollieren lassen
- bei Kau- und Schluckproblemen leicht zu verzehrende Speisen reichen.
Fingerfood ist auch für alte Menschen eine gute Möglichkeit, ohne Besteck zu essen. Die Portionen sollten nicht größer als ein bis zwei Bissen sein, leicht zu greifen und zu kauen und in der Konsistenz nicht zu klebrig. Bei Gewichtsverlust eignen energiereiche Soßen als Dip, die z.B. mit Ölen, Sahne oder Nussmuß angereichert werden. Für warme Mahlzeiten bieten sich Gemüsekuchen oder Pizza in Stücken, Hähnchenbruststreifen, kleine Bratlinge aus Fleisch oder Gemüse, Kroketten, Gnocchi und Fischstäbchen an.
Tipp: Gute Rezepte für Fingerfood für alte Menschen finden sich in der Rezeptdatenbank der DGE nach Eingabe „Fingerfood“.
Quellen: DGE, DAZ 2024, Nr. 9, S. 34, abgerufen am 27.07.2024